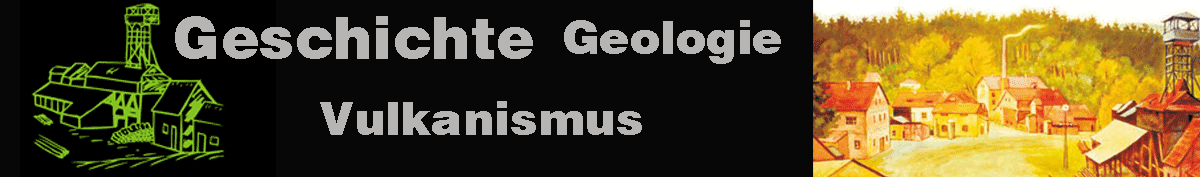
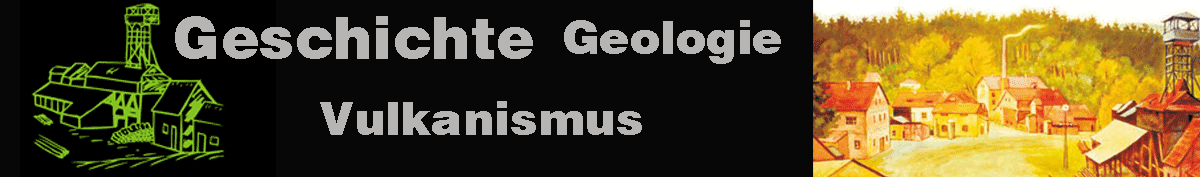
Nach der Schließung der letzten Zeche in Stockheim im Jahr 1968 keimte kurzfristig eine neue Hoffnung auf - Uran wird entdeckt.
1973 wird endgültig entschieden, dass kein Uran abgebaut wird.
Aus https://de.nucleopedia.org/wiki/Uranlagerstätte_Stockheim
Die Uranlagerstätte Stockheim befindet sich im bayerischen Stockheim im Frankenwald. Die Lagerstätte wurde durch Untersuchungen im stillgelegten Katharina-Schacht entdeckt, in der Steinkohle abgebaut wurde. Die Förderung des Vorkommens wurde untersucht, allerdings aufgrund der damals zur Verfügung stehenden Aufbereitungsverfahren nicht durchgeführt. Das Uranvorkommen ist bis heute unberührt.
Nach Ende der Steinkohleförderung im März 1968 im Katharina-Schacht wurde für die Schließung langfristig zunächst Überwachungsarbeiten und Messungen durchgeführt. Im Januar 1969 führte der Bergdirektor des Bergamtes Bayreuth, Joseph Hartmann, radiologische Messungen auf der Sohle in 140 Meter Tiefe durch. Während den Messungen wurden zwei auffällige radioaktive Anomalien festgestellt, weshalb weitere Untersuchungen vorgenommen wurden. Eine Analyse brachte zutage, dass dort die Kohle in der Nähe einer Störungszone eine Urankonzentration zwischen 0,03 und 0,46 % aufwies. Um dieses Uranvorkommen weiter zu untersuchen, wurde im gleichen Jahr von der Bergbaugesellschaft Stockheim Ofr. mbH eine entsprechende Konzession beantragt zum Aufsuchen von Uran in dem Schacht. Die in Bonn ansässige Uranbergbau GmbH beauftragte die Suche zunächst im Bergwerk und später auch übertage.
Die genauen Untersuchungen zeigten, dass das Uran in der Störzone an die Kohle, Kohleschiefer, verschiedene Sandsteinhorizonte und Kalkbänke gebunden ist. Dabei stellte man eine Höffigkeit um 0,01 bis 17 % fest, im Mittel um die 0,4 %. In einer Reihe von Testbohrungen konnte man mehrere Uranerzstrecken auffinden, die um den Schacht verlaufen. Bei den Bohrungen wurde zudem eine weitere Anreicherungszone von Uran aufgefunden werden. Die lagernden Uranmengen wurden auf rund 100 Tonnen geschätzt, nach späteren Angaben des Red Book auf weniger als 100 Tonnen, die aufgrund ihrer hohen Konzentration für wirtschaftlich förderbar eingestuft wurden. Problematisch war allerdings die Aufbereitung des Uranerzes, um das reine Uran zu gewinnen, da bisher nirgends Uran aus Kohle gelöst werden konnte. Man hatte daher Versuche mit alkalischen Lösungen durchgeführt die vielversprechend waren. Trotz der Tatsache, dass das Uran wirtschaftlich gefördert hätte werden können wurden die Explorationsarbeiten und Forschungsarbeiten an der Aufbereitung 1971 eingestellt, da der Aufbereitungsprozess für die kommerzielle Nutzung zur Trennung von der Kohle zu schwierig war und nicht wirtschaftlich.
Der Uranerzaufbereitungsprozess war im Falle der uranführenden Steinkohle in Stockheim deshalb schwierig, da große Rohstoffmassen aus dem Bergwerk hätten aufbereitet werden müssen, was keinen störungsfreien Betrieb einer solchen Aufbereitung gewährleistet. Mit Proben der uranhaltigen Kohle aus Stockheim wurden verschiedene mechanische, thermische und chemische Verfahren im Labormaßstab erprobt, um ein Urankonzentrat für die Weiterverarbeitung zu gewinnen. Um die Kohle vom Uran zu trennen, wurde bei Verbrennung mit mehr als 700 °C eine Verunreinigung der Pechblende durch Uranoxide und Kalziumnitrate festgestellt, weshalb diese nicht angewendet werden konnte und eine Vorbehandlung mit weniger als 600 °C erfolgen musste. Der anschließende Laugungsprozess der Asche bei rund 20 °C mit Schwefelsäure konnte das Uran mit 95 % Reinheit von den Ascheresten abtrennen. Der Aufbereitungsprozess wurde in einem Technikmaßstab wiederholt und auf dessen Basis ein entsprechendes Aufbereitungsverfahren gefunden und empfohlen.
Tatsächlich war während der kurzen Exploration nur ein Teil der Uranflöze zugänglich gewesen, auch durch Bohranlagen, da Gänge zu diesen Vorkommen nicht vorhanden waren. Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass die eigentliche Uranlagerstätte mehr komplex als angenommen ist, sowie weitaus größer. Die Wiederaufnahme der Förderung sowohl der noch in der Lagerstätten befindlichen Kohle zusammen mit der Uranförderungen wurde noch bis 1974 erörtert, möglicherweise mit staatlichen Fördermitteln, wurde allerdings von Wirtschaftsminister Anton Jaumann (CSU) mit der Begründung abgelehnt, dass das Fördervolumen des Urans, als auch der Kohle zu klein gewesen wären, als dass es dafür eine wirtschaftliche Basis geben würde und diese Mengen für die Energieversorgung keinerlei Bedeutung haben würden.[8] Die kurze Explorationsarbeit in Stockheim qualifizierte einen Teil der Bergleute dazu, sich auf dem Gebiet zu qualifizieren, weshalb die Uranbergbau GmbH diese Arbeiterschaften aus Stockheim zur Uranprospektion im Schwarzwald, Österreich, sowie in den afrikanischen Staaten Togo und Tansania einsetze. Mit dem Ende der Uranexploration in Stockheim endete nach 225 Jahren auch der Bergbau in der oberfränkischen Gemeinde.
Geologie
Steinkohleflöz in Stockheim
Die ersten Untersuchungen zeigten bereits schnell, was zu diesem Zeitpunkt 1969 noch nicht bekannt war, dass sich das Uran an die Kohleflöze gebunden hatte. Die Entdeckung in Stockheim war weltweit die erste ihrer Art. Die Entstehung wurde erklärt durch Diagenese und Epigenetik. Das Uran befindet sich in Form von Pechblende klar sichtbar in der größten Störungszone der Kohlelagerstätte, der Hasslachverwerfung mit einer Breite von 6 Metern, nicht jedoch von den Wänden und Decken der Schächte hängend. Dies liegt unter anderem daran, dass die hoch konzentrierten Uranlagerstätten erst in einer Tiefe unterhalb 748 Meter Untertage auftreten, davon die höchste Urankonzentration von 1180 Parts per Million Triuranoctoxid auf 784 bis 788 Meter. Eine Lagerstätte mit ähnlichen Aufbau befindet sich in der Uranlagerstätte Steinach bei Gräfenthal, nördlich des Vorkommens in Stockheim, wo ebenfalls die Uranlagerstätten in Störungszonen der Kohle liegen.

AI Website Creator